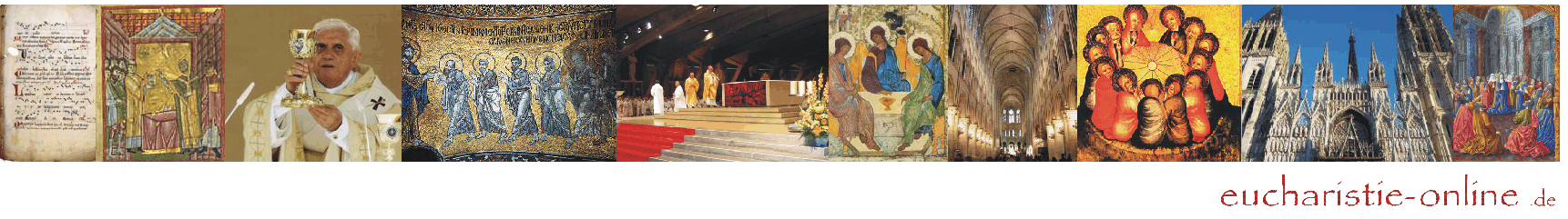
Die nachfolgende Darstellung zeichnet die
geschichtlichen Entwicklungslinien der liturgischen Feier der
Eucharistie nach.
Für einen Überblick über die theologiegeschichtlichen Entwicklungen
siehe
hier
Die Feier der Eucharistie, in frühchristlicher Zeit auch als Herrenmahl (1 Kor
11,20) oder Brotbrechen (Apg 2,42) bezeichnet, ist seit ihren Anfängen für die
Kirche zentral. Die christliche Praxis steht der Bedeutung nach in einem inneren
Zusammenhang mit dem sog. Letzten Abendmahl, das Jesus - so das Zeugnis der
neutestamentlichen Schriften - am Abend vor seinem Leiden und Sterben mit den
Seinen gefeiert hat.
Auch beim Letzten Abendmahl ist der Zusammenhang mit der Tradition Israels offensichtlich. Jesus erscheint hier wie ein jüdischer Hausvater als Gastgeber bei einem festlichen Mahl, der mit seinen Gästen zu Tisch liegt. Entsprechend der jüdischen Tradition spricht Jesus zu Beginn des Mahles den Segen über das Brot. Er nimmt das Brot, bricht es und verteilt es an die Anwesenden. Innerhalb dieses traditionellen Rahmens aber setzt Jesus einen ganz eigenen Akzent und hebt das Letzte Abendmahl so als besondere Zeichenhandlung heraus: In einem ausdeutenden Wort über das Brot macht er den Seinen deutlich, dass er in diesem Brot ihnen sich selbst dargibt, und zwar als einer, der im Gehorsam gegenüber dem Vater nun in den Tod geht. Ebenso handelt Jesus beim Segensbechermit Wein, der zum Abschluss des jüdischen Festmahles (vgl. Nach-Tischgebet birkat hammazôn) gereicht wird. Wiederum spricht Jesus ein eigenes Begleitwort und deutet so den Wein als sein eigenes Blut, und zwar offenbar im Sinne des Bundesblutes (Mk 14,24 < Ex 24,8). Schließlich gibt Jesus den Seinen aus seinem eigenen Kelch zu trinken, statt dass - wie beim jüdischen festlichen Mahl üblich - jeder aus seinem eigenen Becher trinken würde. Insofern also Jesus selbst am Abend vor seinem Leiden mit den Seinen ein solches Mahl gefeiert hat, dabei Brot und Wein explizit auf sich selbst im Hinblick auf seinen bevorstehenden Tod bezogen und den Seinen Anteil daran gegeben hat, kann von einer wirklichen Einsetzung des eucharistischen Mahles durch Jesus selbst gesprochen werden. Immerhin gilt das Faktum des Letzten Abendmahls als historisch und seine Darstellung in den Schriften keineswegs nur als rückprojizierte ex post Verankerung der frühchristlichen Herrenmahlpraxis im Leben Jesu.
In den Texten des Neuen Testaments, die vom Letzten Abendmahl handeln, besteht trotz jeweiliger Akzentuierungen (vgl. verarbeitete Quellen, Redaktionskontext, theologisches Verständnis, Verkündigungsabsicht, Wortwahl) ein Konsens im Kern, der in einer gemeinsamen Wurzel, offenbar einem sehr alten Traditionsstück aus der jerusalemer Urgemeinde, gründet. Hierauf basieren die beiden Überlieferungsstränge zum Letzten Abendmahl im Neuen Testament, wie sie einserseits in Mk 14,22-24 und andererseits in 1 Kor 11,23-26 zum Ausdruck kommen. Paulus spricht in V 23 ausdrücklich davon, dass er diese Überlieferung, die er hier im ersten Brief an die Korinther weitergibt, seinerseits schon empfangen hat. Dabei weist der paulinische Abschnitt eine griechischere Sprachform als der entsprechende Abschnitt bei Mk auf. Zudem erscheint der paulinische Text theologisch reflektierter, was im Verständnis des Neuen Bundes (vgl. Jer 31,31) im Blute Jesu sowie im Moment der Christusanamnese zum Ausdruck kommt. Der zweimal genannte Wiederholungsauftrag "tut dies zu meinem Gedächtnis" entstammt offenbar der frühen, bereits vorpaulinischen Herrenmahlpraxis und dürfte von hier aus in 1 Kor eingegangen sein. Der Abschnitt Lk 22,14-20 basiert auf denselben Traditionen wie 1 Kor 11,23-26. Mt 26,26-29 hingegen geht redaktionell auf Mk zurück. Insgesamt also lassen sich im Neuen Testament mit Mk/Mt und 1 Kor/Lk zwei Darstellungsweisen zum Herrenmahl mit je eigener Akzentuierung unterscheiden.
Die Darstellung im Johannesevangelium unterscheidet sich von diesen beiden Traditionen nochmals ganz erheblich: Joh 13,2 bezeugt lediglich das Faktum, dass es ein Mahl am Abend des 13. Nisan (vermutlich des Jahres 30), d.h. am Abend vor dem Rüsttag zum Pesachfest gegeben hat. Inhaltlich berichtet Joh 13 über das Mahl allerdings nichts; stattdessen wird die Fußwaschung, die im Zusammenhang mit diesem Mahl stattfindet, und nicht das Mahl selbst als besondere Zeichenhandlung Jesu eigens hervorgehoben (und zwar nicht als eines jener sieben "Zeichen" (semeia), die für das Joh-Ev kennzeichnend sind, sondern dem finalen Höhepunkt im siebten Zeichen des Leidens, des Todes und der Auferstehung Jesu, d.h. dem Zeichen schlechthin zugehörig). Anders als bei den Synoptikern wird bei Joh der eucharistische Bezugspunkt nicht im Zusammenhang mit dem Mahl Jesu vor seiner Verherrlichung, sondern in Joh 6 überliefert.
Die kerygmatische Dimension erhält in der Textgattung "Evangelium", die aus österlicher Perspektive dem Anliegen der Christus-Verkündigung gewidmet ist, berechtigterweise den Vorrang vor der Frage nach der historischen Exaktheit. Gemäß dem Ideal antiker Geschichtsschreibung rückt die Joh-Redaktion durch ihre Akzentuierungen ja gerade die eigentliche Wahrheit dessen, was zur Aussage kommen soll, in-über den historischen Fakten ins Licht. Dementsprechend sind Evangelientexte keine Protokollaufzeichnungen zum Leben Jesu. In theologisch motivierter redaktioneller Auseinandersetzung mit den vorliegenden Traditionsstücken arbeitet auch das Joh-Ev die Wahrheit über Jesus, den Christus, heraus, und zwar auf die ihm eigene, spezifische Weise. Im johanneischen Konzept vom Zeichen kommt das Zeugnis für Gottes erfahrbar gewordenes Heilswirken zum Ausdruck; dies hat seine vorösterliche Entsprechung im vielfältigen Heilshandeln Jesu. Joh gebraucht den Begriff des Zeichens in einem spezifischen Sinn mit starkem theologischem Gewicht: In den Zeichen kommt Jesus als der vom Vater gesandte Sohn zur Darstellung. Die Zeichen offenbaren, wer Jesus eigentlich ist. Daher stellen sie für Joh einen wesentlichen Modus dar, Jesus als den Christus zu verkünden.
Joh 6 greift ausgewählten synoptischen Erzählstoff auf (vgl. Mk 6,32-52 und Mk 8,1-30), Jesu Wirken in Galiläa betreffend, bereitet diese Stoffe entsprechend bestimmter theologischer Motive redaktionell gezielt auf und setzt so in der Textdarstellung deutlich eigene theologische Akzente. Das Textstück Joh 6, das durch das Zeichen der Speisung der Menge und das thematisch darauf bezogene Jesus-Wort vom Brot geprägt ist, stellt in der Entsprechung von physischer Speisung und Speisung durch das Wort (vgl. atl. Zusammenhang von Brot und Wort: Dtn 8,3b; Weish 16,26; Jer 15,16; Am 8,11) eine zusammenhängende Komposition dar. Jesus selbst ist das Brot des Lebens, welches bleibt ins ewige Leben, das "wahre Brot aus dem Himmel" im Unterschied zum Manna, dem "Brot aus dem Himmel", das Gott den Vätern in der Wüste gegeben hat. Das "Essen" des Brotes bedeutet eine tiefere Form der Teilnahme am Zeichen Jesu als das bloße "Sehen" der Zeichen. Das Essen ist das größere Sehen. Das Motiv des (eucharistischen) Essens wird in besonderer Verdichtung am Ende der Rede Jesu VV 51-58 vertieft.
Der Glaube ist kein Menschenwerk; er verdankt sich zutiefst dem Wirken Gottes. Den Zeichen mag dabei eine gewisse maieutische Funktion zukommen. Diese sind "aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen" (Joh 20,31). Die Zeichen vertiefen den Zugang zum Glauben; insofern bedeuten sie Heil. Für jene, die sich ihrer Tiefendimension verschließen und nicht zum Glauben kommen, bedeuten sie für Joh das Gericht.
Dass die synoptischen Texte das letzte Abendmahl als Pesachmahl darstellen, was es am Abend jenes 13. Nisan als Vorabend zum Rüsttag de facto aber nicht gewesen sein kann, dürfte ihrem theologischen Verständnis sowie der Praxis der frühchristlichen Paschafeier geschuldet sein. Mit der Ostererfahrung der ausgewählten Zeugen, verbunden mit der Einsicht, dass Jesus der Christus, der Erhöhte, der in der Herrlichkeit des Vaters vollendete Sohn Gottes ist, genau dieser Jesus, mit dem sie zuvor zusammen gelebt haben, erscheinen Jesu irdisches Leben, Lehren und Wirken sowie sein Leiden und Sterben in einem neuen Licht.
Die historische Dimension dieser Ereignisse erscheint nun aus der Perspektive der neu aufgebrochenen eschatologischen Dimension ausgedeutet, die jedoch allein im Glauben eröffnet ist. Bei Jesus handelt es sich ja nicht nur um eine historische Person (dies natürlich auch), sondern ebenso um den Christus, den erhöhten Herrn. Die junge Kirche bekennt, dass der ihnen bekannt und vertraut gewordene Jesus der Christus-Messias, dass er der Kyrios ist (1 Kor 12,3; Röm 10,9; Phil 2,11). Im Licht der Ostererfahrung wird der jungen Kirche die Tiefendimension des historischen Lebens Jesu, seines Leidens und Sterbens und damit auch des Letzten Abendmahles bewusst. Die Kirche nimmt fortan mit der iterativen Feier des Herrenmahles Jesu Zeichenhandlung kultisch auf und nimmt so an Person und Sendung Jesu Christi teil. Die Aufnahme dieser Zeichenhandlung erfolgt jedoch keineswegs historisierend-imitierend, sondern im Verständnis von Ostern her interpretierend und der Form nach variierend-gestaltend.
frühchristliche Herrenmahlpraxis
Findet das Brotbrechen der Christen zunächst noch gemäß jüdischer Tradition zu Beginn des Hauptmahles, die Becherhandlung hingegen als Teil des Gebetes zum Abschluss des Mahles statt, werden Brotbrechen und Becherhandlung schon früh, um das Jahr 40, zu einer eigenständigen Einheit zusammengezogen und aufeinander abgestimmt als Doppelhandlung zum Ende des Mahles gefeiert. Kultisches Herrenmahl und brüderliches Agapemahl, das aus der ursprünglichen Sättigungsmahlzeit hervorgeht, werden so stärker unterscheidbar und treten de facto allmählich gänzlich auseinander, bis die Agape schließlich völlig verschwindet. Die Feiergestalt des Herrenmahls ist jedoch keineswegs einheitlich und variiert zwischen den einzelnen Gemeinden. Als Bezugspunkt erweist sich das im Mittelmeerraum verbreitete abendliche Symposion, das die Hauptmahlzeit des Tages umfasst. Erst im 3. Jhd hat sich für die Feier des Herrenmahles die Orientierung an der ntl. Abendmahlsüberlieferung in der Form des paulinisch-anamnetischen Feiertypus vollends durchgesetzt.Die zum Volk der Juden gehörenden Glieder der jungen Kirche in Jerusalem bleiben in der jüdischen Tradition verwurzelt und nehmen auch weiterhin mit Selbstverständlichkeit und Eifer am Tempelkult teil (vgl. Apg 3,1). Darüber hinaus aber werden auch in Jerusalem erste Differenzierungen sichtbar, wie z.B. die besondere Form der Gemeinschaft (vgl. Apg 2,44; 4,32). Die spezifisch christlichen Feiern, zu denen in erster Linie das Herrenmahl gehört, finden im Rahmen von Versammlungen in Privathäusern, wie etwa dem Obergemach in Jerusalem (vgl. Apg 1,13), statt. "Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt" (Apg 2,46-47a).
Erst allmählich erfolgt eine wechselseitige Abgrenzung zwischen jenen Juden, die Jesus als den Christus bekennen, und den anderen, die nicht an ihn glauben. Einerseits grenzen jüdische Autoritäten zunächst die Apostel (vgl. Apg 5,17-40) und schließlich auch alle übrigen Anhänger des neuen Weges aus. Mit der Steinigung des Stephanus (Apg 7) setzen erste Formen der Verfolgung ein (Apg 8,1b). So "versuchte Saulus die Kirche zu vernichten; er drang in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und lieferte sie ins Gefängnis ein" (Apg 8,3). Andererseits tritt für die Christen mehr und mehr ihr Proprium in den Vordergrund. Mit der Annahme des Glaubens durch eine zunehmende Anzahl Heiden verschiebt sich das Bezugssystem der jungen Kirche zunehmend weg vom jüdischen Kontext. So kommt es allmählich zu einer Trennung der Wege von Juden und Christen. Der sukzessive Bruch zwischen Kirche und Synagoge schreitet allerdings je nach Region unterschiedlich schnell voran und ist in einigen Teilkirchen erst mit der Konstitution der Reichskirche im 4. Jhd. bzw. auf jüdischer Seite mit der Konsolidierung des rabbinischen Judentums abgeschlossen. Während dieser Jahrhunderte gelangen sowohl christlicher als auch jüdisch-synagogaler Gottesdienst zu weiterer Ausprägung und gewinnen währenddessen allmählich eine feststehende Gestalt. Beide schöpfen in diesen vielfach parallel sich vollziehenden Prozessen aus einem gemeinsamen biblischen (=alttestamentlichen) und kultischen Erbe, teilweise in wechselseitiger Beeinflussung, teilweise in Abgrenzung gegeneinander. Keineswegs also ist der christliche Gottesdienst unidirektional aus einer festestehenden jüdischen Form hervorgegangen.
Mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 dezentralisiert sich der Schwerpunkt des religiösen Lebens und verlagert sich verstärkt auf die Hausgemeinschaften, jüdischerseits auch auf die Synagogen. Dadurch wird bei Juden und Christen die Entwicklung von neuartigen Formen gottesdienstlichen Feierns begünstigt, die an die Stelle des bisherigen Tempelkults treten. Besteht der Synagogengottesdienst im 1. Jhd. weitgehend aus Schriftlesung und Erklärung der Bücher der Thora und der Propheten, setzt im 2./3. Jhd. eine Erweiterung zum Gebetsgottesdienst ein, in den mit dem Vortrag von Gebeten und Psalmen Elemente aus dem früheren Tempelkult Eingang finden. Das jüdische Achtzehngebet tritt an die Stelle der Opfer, die vormals täglich im Tempel dargebracht wurden. Sogar eine christliche Fassung des jüdischen Achtzehngebets für den Sabbat findet sich in den späteren Apostolischen Konstitutionen überliefert. Heidenchristen wollten offenbar auf diese Weise Judenchristen die Integration in das Gemeindeleben erleichtern. Die jüdische Gebetsform der Beraka, eines kurzen Segenslobpreises bestehend aus einer einzigen erweiterten Anrufung, erlangt auch unter den Christen weite Verbreitung (eulogetos vgl. Lk 1,68; Eph 1,3; 1 Petr 1,3). Inhaltlich jedoch setzen die Christen immer stärker eigene Schwerpunkte, so auch bei der Beraka über Brot und Wein, die sie christlich interpretieren und überformen (vgl. Didaché). Christliche Transformation und eine zunehmende Eigengestalt finden sich insbesondere bei längeren Gebetsformen wie Hochgebeten, Gebeten zur Taufwasserweihe oder zur Ordination. Die Zeugnisse für das frei vorgetragene eucharistische Hochgebet aus dem 1. und 2. Jhd. belegen eine breite Gestaltungsvielfalt der eucharistischen Praxis. Einige frühe Überlieferungen lassen die Feier des Herrenmahles in enger Anlehnung an das mediterrane Symposion erscheinen. Weisen frühe Formen des Hochgebets wie etwa das Eucharistiegebet in der Didaché (um 100) oder die syrische Anaphora von Addai und Mari noch direkte Entsprechungen zum jüdischen Nachtischgebet auf, zeigt sich die jüdisch-christliche Verwandtschaft bei späteren Gebetstexten vor allem formal in deren zweiteiliger Struktur: In einem ersten, anamnetischen Teil wird Gott für seine erwiesene Großtat in der Geschichte gepriesen. Vor diesem Hintergrund der manifestierten Heilsgeschichte werden in einem zweiten, epikletischen Teil Bitten an Gott gerichtet. Inhaltlich setzen die Christen verstärkt eigene Akzente, etwa durch die Hervorhebung des Brotbrechens, das der ganzen Herrenmahlfeier zeitweise den Namen gab, durch die Einchristlichung von bestehenden Gebetstexten oder durch die Bezugnahme auf die Einsetzungsworte innerhalb des Hochgebets seit dem 2./3. Jhd. Analog zur synagogalen Praxis etabliert sich ein Wortgottesdienstteil mit Schriftlesung und Auslegung, wobei Art und Anzahl der Lesungen zwischen den einzelnen Ortskirchen variieren.
Justin, der Märtyrer, gibt durch seine Darstellung in der Ersten Apologie einen Einblick in den Ablauf einer sonntäglichen Eucharistiefeier um das Jahr 150. Nach Schriftlesung und einer Ansprache durch den Vorsteher folgen das Allgemeine Gebet und der Friedenskuss. Dann werden Brot, Wein und Wasser zum Vorsteher gebracht. "Dieser nimmt die Gaben entgegen und sendet dem Vater des Alls durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis empor und verrichtet eine längere Danksagung dafür, dass wir durch ihn dieser Gaben gewürdigt werden. Wenn er die Gebete und die Danksagung beendet hat, stimmt das ganze anwesende Volk mit Amen zu." Dann teilen Diakone jene Gaben von Brot und Wein, über die das Hochgebet gesprochen worden ist, an die Gläubigen aus und lassen auch die abwesenden Gemeindeglieder daran teilhaben.
Einen direkten Hochgebetstext überliefert Justin nicht. Ein solcher findet sich immerhin in der aus der Zeit zwischen 210 und 235 stammenden Traditio Apostolica. Das Hochgebet beginnt mit einem dreigliedrigen Dialog zwischen dem Vorsteher und den übrigen Teilnehmern als Einleitung in die Präfation. Darauf folgt eine große Danksagung in Form einer Christusanamnese, die in die Einsetzungsworte mündet. Daran schließen Anamnesegebet mit Darbringungsbitte und Epiklese an, welche zur Doxologie führen und schließlich durch Amen-Akklamation abgeschlossen werden.
Mit der wachsenden Distanz zu den ersten Zeugen sowie in Abgrenzung gegenüber vielfältigen Kulturen und Kulten, die in das Römische Großreich hinein assimiliert werden, insbesondere gegenüber gnostischem Gedankengut, hellenistischem Synkretismus und der zunehmenden Präsenz von Mysterienreligionen verschärft sich für die Gemeinden die Frage nach ihrer eigenen, christlichen Identität. Dabei gewinnt die Bezugnahme auf ihre objektiven, historischen Grundlagen und in diesem Zusammenhang insbesondere der Rückbezug auf die Apostel an Bedeutung. Texte erheben nun Anspruch auf apostolische Urheberschaft. Der Glaubensregel wächst apostolische Autorität zu, ungeschriebene Traditionen werden durch ihren behaupteten apostolischen Ursprung begründet und - etwa im Osterfeststreit - nachhaltig vertreten. Einzelne Gemeinden führen ihre Entstehung nun auf die Gründung durch einen der Apostel zurück und belegen durch Namenslisten eine bis auf die Apostel zurückreichende, ungebrochene Traditionskette ihrer Vorsteher (Papias, Hegesipp). Die erstarkenden Episkopen verkörpern damit die Kontinuität zum Ursprung gleichsam in Person. Zugleich beginnt Mitte des 2. Jhd. der Prozess einer Konzentration aller Leitungsfunktionen innerhalb des Gemeindelebens auf einen einzelnen Episkopen (vgl. Ignatiusbriefe Ende (!) des 2. Jhd.; von einem monarchschen Episkopat im Sinne des Bischofsamts kann jedoch angemessenerweise nicht vor dem 3./4. Jhd. gesprochen werden). Den Vorsitz bei der Feier der Eucharistie nimmt der Episkope in Gemeinschaft mit der Gruppe der Presbyter wahr.
Die Entwicklung der Christologie mit der Frage nach dem Verhältnis von Gottsein und Menschsein in Jesus Christus sowie der Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Leib des historischen Jesus (einschließlich seines Leidens und Todes) und dem eucharistischen Leib führen vor allem im Westen zu einem ausgeprägten Opferverständnis der Eucharistie (Vorstellung einer stets erneuten, realistisch-iterativen Darbringung des Kreuzesopfers Jesu Christi; s.u. Kapitel 11, abendländisch-lateinische Patristik) und damit einhergehend zur Ausbildung einer christlichen Priestervorstellung seit der Zeit Tertullians Ende des 2. Jhd. So wächst dem Episkopen mit der Entwicklung der Eucharistiefeier, bei der er gemeinsam mit den Presbytern den Vorsitz innehat, hin zu einer gottesdienstlich-kultischen Form, eine (opfer)priesterliche und mystagogische Aufgabe zu, die seine Position analog zur anerkannten Stellung der Priester der im öffentlichen Leben etablierten Kulte noch weiter stärkt (Cyprian von Karthago).
Entwicklungen im Kontext der Römischen Reichskirche
Mit dem Ende der großen Verfolgungen im Römischen Reich und dem Anschluss immer größerer Teile der Bevölkerung an die aus der Verborgenheit heraustretenden Kirche ändert sich mit deren äußerer Situation auch die Gestalt des Gottesdienstes. Seit Mitte des 3. Jhd. gewinnt die lateinische Sprache in den westlichen Provinzen im christlichen Gottesdienst an Bedeutung. Die Reichsteilung im 4. Jhd. verschiebt den politischen, geistigen, kulturellen und kultischen Schwerpunkt des Römischen Reiches in das als christliches Gegenstück zum paganen Rom eigens errichtete Konstantinopel.Im Westteil des Reiches hingegen ist man bestrebt, an der traditionellen Bedeutung der Stadt Rom festzuhalten, und betont nun wieder verstärkt die eigene lateinische Kultur. In diesem Kontext kommt es zur Ausprägung einer gänzlich lateinischen Liturgie. Dabei wird die bisherige griechischsprachige Liturgie nicht etwa übersetzt; vielmehr wird das ganze liturgische Geschehen in die lateinische Lebenswelt und das westlich-lateinische Lebensgefühl transponiert. Statt der bisher vorherrschenden Gestalt einer hymnisch-lobpreisenden Doxologie, einer Lobpreisung Gottes in überströmenden Worten, so viel man nur vermag, etabliert sich nun im Westen, lateinischer Tradition entsprechend, eine eher knappe, periodische Sprache (vgl. Orationen). Statt der ganzen Oikonomia Gottes in überströmendem Lobpreis zu gedenken, macht sich die abendländisch-lateinische Form der Anamnese stets möglichst konkret an einzelnen Heilstaten fest (vgl. Entstehung festanlassbezogener Präfationen). Statt sich dem Mysterion der Großtat Gottes insgesamt dankbar-gedenkend und antwortend-lobpreisend auszusetzen, wird eher auf das konkrete historische Geschehen (res gestae) und demgemäß auf den Einsetzungsbericht mit Herrenworten Bezug genommen, werden eher einzelne Aspekte wie z.B. Darbringung, Bitte um Annahme oder konkrete Fürbitten im liturgischen Handeln differenziert zum Ausdruck gebracht. So muss der Römische Kanon (vgl. Hochgebet I) als durch und durch römisch-lateinisches, aus Einzelstücken zusammengesetztes Kunstwerk erscheinen, dessen Struktur den Idealen spiegelbildlicher Symmetrie und lateinischen Periodenbaus entspricht.
Die christologischen und trinitätstheologischen Auseinandersetzungen, die seit dem 4. Jhd. in aller Heftigkeit und auf zahlreichen Synoden und Konzilien ausgetragen werden, wobei Konzilsbeschlüsse vielfach den Status kaiserlicher Gesetze und damit eine juridische Dimension erlangen und kirchliche Fragen zum Gegenstand der Reichspolitik avancieren, begünstigen eine stärkere Normierung auch der Gottesdienste, insbesondere des Hochgebetes ("Canon" : "Richtschnur"). Die bislang innerhalb eines Schemas weitgehend freie Gebetsrede wird durch feststehende Texte abgelöst. An das Hochgebet schließen sich Vorbereitungsriten auf die Mahlkommunion an. Dazu gehören das Gebet des Herrn sowie der Friedensgruß, der bislang vor dem eucharistischen Teil der Feier seinen festen Platz innehatte, und nun, einer Gepflogenheit Nordafrikas entsprechend, direkt vor die Kommunion verlegt wird. Die stadtrömische Bischofsliturgie mit der für sie typischen Versammlung an einer statio und anschließender Prozession zu einer der Hauptkirchen Roms führt zur Ausprägung von Eröffnungsriten (Einzug, Kyrie, Gloria), die schließlich einen festen Platz in der Eucharistiefeier erhalten.
fränkisch-germanische Einflüsse
Der Niedergang des weströmischen Reiches und die Erstarkung der fränkisch-germanischen Volksgruppen bleiben nicht ohne Konsequenzen für die Feier der Eucharistie im Westen. Gemäß fränkisch-germanischem Verständnishorizont verschiebt sich der Fokus von der realsymbolisch verstandenen Feier des Mysterion (= sacramentum) verstärkt hin auf einen eher dinglich-gegenständlichen Realismus, in dem der altkirchlichen, griechisch geprägten Verständnisweise von "Symbol" keine rechte Bedeutung mehr entspricht. In seiner Konsequenz konkret greifbar wird dieser Paradigmenwechsel auch im Bereich der Kirchenmusik, z.B. in der Tropierung (= Unterlegung jeder einzelnen Note mit einer Textsilbe) der im Sinne eines Jubilus überströmenden Halleluja-Melismen, woraus die im Volk beliebten liedhaften Sequenzen hervorgehen, deren Texte jedoch häufig lehrmäßig zu beanstanden sind.Mit der Erstarkung des Frankenreichs tritt im 8. Jhd. unter den Karolingern das Bestreben nach einer größeren politischen und kulturellen Einheitlichkeit unter den heterogenen Volksgruppen in den Vordergrund. Dies betrifft auch die in den einzelnen Regionen auf sehr vielfältige Weise gefeierte eucharistische Liturgie, die in der Form gallikanischer Riten mit regionalen Besonderheiten verbreitet ist. Seit Mitte des 8. Jhd. werden verstärkt liturgische Bücher zusammengestellt, in die neben den als normativ geltenden römischen Quellen, die jedoch vor allem der feierlichen Form der Stationsliturgie entstammen, auch lokale Eigentraditionen und Elemente privater Frömmigkeit Eingang finden. So kommt es zur schriftlichen Fixierung von diversen gallisch-fränkischen Ausprägungen der römischen Bischofsliturgie, die auf die ländlich-einfacheren Verhältnisse in den fränkischen (vielfach monastisch-klösterlichen) Zentren adaptiert wird (vgl. Hauptaltar und Seitenaltäre als Abbild für die römischen Stationskirchen) und in diesen Ausformungen im Laufe der Zeit schließlich die liturgische Praxis im gesamten Abendland maßgeblich beeinflusst.
Die Konzentration der Eucharistiefeier wie überhaupt aller liturgischer Feiern auf den Klerus, d.h. insbesondere auf eine sich emanzipierende und zahlenmäßig bis auf eine Größenordnung von ein oder zwei Prozent an der Bevölkerung stark anwachsende Priesterklasse, der aufgrund der Einbindung der kirchlichen Strukturen in das Feudalgesellschaftswesen im Frankenreich eine anerkannte soziale Stellung zukommt, als dem eigentlichen, allmählich gar alleinigen Träger der Liturgie, der in der ihm übertragenen Vollmacht die Messe liest, an der das Volk von Laien lediglich beiwohnt (die Messe "hört" ), manifestiert sich zusätzlich in der räumlichen Trennung von Altarraum und Kirchenschiff etwa durch Aufrichtung von Altarschranken (Lettner) sowie am liturgischen Gebrauch der im Volk nicht geläufigen lateinischen Sprache. Seit dem 9. Jhd wird der um zahlreiche Privatgebete und Gebärden wie etwa Verneigungen und Kreuzzeichen angereicherte Kanon zudem nur noch leise gesprochen, so dass er außerhalb des Altarraums unhörbar bleibt.
An die Stelle der Gabenprozession tritt eine vom germanischen Opfergedanken her geprägte Gabenbereitung. Diese wird analog zum Kanon durch Darbringungsgebete überformt ("kleiner Kanon"). Dabei tritt das germanisch-fränkische Opferverständnis im Sinne eines auf konkrete Anliegen bezogenen Darbringens "für" in den Vordergrund. Die aus dem Bereich des Opferkultes stammende Bezeichnung "hostia" verdrängt nun die Bezeichnung "oblata" , die im 4. Jhd. ihrerseits an die Stelle von "eucharistia" getreten war. Anstelle lobpreisender Danksagung tritt entsprechend germanischer Denkart der Opfergedanke mit Akzent auf Bitte und Sühne verstärkt in den Vordergrund. In der Feier der Eucharistie scheint Gnade damit gleichsam dinglich greifbar zu werden. Deren Früchte kommen in spezieller Weise dem zelebrierenden Priester zugute, die dieser jedoch gemäß seiner Intention z.B. für das ewige Heil eines Verstorbenen oder die Erlangung eines bestimmten Anliegens applizieren kann. Die Gläubigen bringen ihre Gaben - statt zur weggefallenen eucharistischen Gabenprozession - nun als direkte Zuwendung für den Lebensunterhalt des Priesters; im Gegenzug erhalten sie gemäß germanischem Vertragsverständnis Anspruch auf Zuwendung der qua Intention aus der Messfeier vermittelten Gnadengabe. In der Folge nehmen die Anlässe für die Eucharistiefeier und damit deren Häufigkeit rapide zu. So entstehen Formulare für immer weitere Heiligengedächtnisse, für Votivmessen sowie für alle Wochentage. Das mittelalterliche Stiftungs- und Stipendienwesen führt zu einer extremen Zunahme an geweihten, meist ungebildeten, vagabundierenden Priestern, die sich mit Messelesen in industriellem Maßstab durchschlagen. Versuche, die Auswüchse zu beseitigen, bleiben erfolglos: So führt z.B. die Verfügung einer Beschränkung auf eine Messe pro Altar und Tag statt zu einer Reduktion der Messenanzahl zur Anlage von zusätzlichen Seitenaltären in den Kirchen.
Akzentuierungen im Mittelalter
Die stille Messe ohne Gesang und Assistenz, häufig allein durch den Priester als Privatmesse ohne sonstige Teilnehmer in einer bestimmten Intention gelesen, wird de facto zum Regelfall. Aus dieser Perspektive erscheinen darüber hinausgehende Elemente wie Assistenz und Gesang als zeremonielles Beiwerk, das für feierliche Anlässe durchaus angemessen erscheint, ansonsten aber durchaus entfallen kann, ohne die rechtliche Gültigkeit der Messe zu beeinträchtigen. Die gemäß der Praxis der päpstlichen Kapelle geformte, von der seit der gregorianischen Reform erstarkten römischen Kurie ausgehende feierliche Form der Messliturgie (Ordo Missae secundum usum Romanae Curiae) wird lediglich für die feierlichen Hauptgottesdienste an Sonntagen und Hochfesten maßgeblich (vgl. levitiertes Hochamt). Umgekehrt etabliert sich auch an der Römischen Kurie die Praxis der nichtöffentlichen, stillen Messe, so dass Anfang des 13. Jhd. ein entsprechender Ordo Missae erlassen wird, der insbesondere durch den Franziskanerorden rasch im ganzen Abendland Verbreitung findet. Durch die Vorschrift, dass bei jeder Messe zumindest ein Altardiener zugegen sein müsse, soll den gröbsten Auswüchsen bei der Praxis der Privatmessen begegnet werden.Die im Abendland vorherrschende, am Paradigma eines gegenständlichen Realismus ausgerichtete, Denkform fördert ein Eucharistieverständnis, das überwiegend an der dinglichen Seite des Sakraments, insbesondere an der Brotsgestalt, orientiert ist. Gesteigerte Ehrfurcht, Angst vor Verschütten des Kelches oder dem Verlorengehen kleinster Brotpartikel führen zu einer veränderten Kommunionpraxis. Die Kelchkommunion kommt gänzlich aus der Übung, was durch die Konkomitanzlehre im 13. Jhd. theologisch legitimiert wird. Seit dem 9./10. Jhd. verwendet man bei der Feier der Eucharistie ein spezielles ungesäuertes Brot, das mit gewöhnlichem Brot nichts mehr gemein hat. Dieses wird für die in Übung kommende Mundkommunion, die man seit dem 11. Jhd. zudem in kniender Haltung empfängt, in Form kleiner, mundgerechter Hostien gebacken. Das praxisbedingte Brechen eines Brotes entfällt daher und reduziert sich auf eine symbolische Handlung an der Priesterhostie.
Ohnehin geht die Kommunionhäufigkeit immer stärker zurück, so dass das IV. Laterankonzil 1215 die zumindest einmal jährliche Kommunion zu Ostern für alle Gläubigen verbindlich vorschreibt. Analog zur Gabenprozession verschwindet mit dem Rückgang der Kommunionhäufigkeit auch die Kommunionprozession. An die Stelle der realen Teilhabe an dem einen Brot tritt dessen verehrende Anschauung (Augenkommunion) und Anbetung. Seit 1200 verbreitet sich von Paris aus der Brauch der postkonsekratorischen Elevation der Priesterhostie, die zu diesem Zweck stilisiert vergrößert gestaltet wird.
Die Teilhabe des Volkes reduziert sich auf die Beiwohnung an einer kleruszentrierten Eucharistiefeier, deren Mitte zunehmend in einem an den Herrenworten direkt festzumachenden Akt der Konsekration gesehen wird. Das Wandlungsläuten zeigt den im Kirchenschiff abseits vom Altarraum versammelten Gläubigen den Moment dieses metaphysischen Ereignisses an, das im Hochmittelalter in der Lehre von der Transsubstantiation theologisch entfaltet wird. Aus Paris wird von Menschen berichtet, die im Extremfall von Kirche zu Kirche eilen, um gerade noch rechtzeitig dem Moment der Konsekration (Wandlung) beiwohnen, die erhobene Hostie schauen und so persönlichen Anteil an der vermittelten Gnade erhalten zu können. Da die Konsekrationsformel, die als Wirkursache der Transsubstantiation verstanden wird, halblaut gesprochen wird, verfestigt sich nicht nur im Volk ein reduziertes Eucharistieverständnis als abergläubisches Zerrbild des eucharistischen Geschehens (Die Formel "hokuspokus" stammt allerdings erst aus dem 17. Jhd.; zudem ist deren etymologischer Bezug zur Konsekrationsformel keineswegs eindeutig).
antireformatorische Akzentuierung
Vorherrschende Mißstände, verbreitete magisch-abergläubische Vorstellungen, die sich auch in der Praxis der Messfeier niederschlagen, sowie der gegenreformatorische Impetus des Konzils von Trient (1545-1563) führen zu einer Überarbeitung des Messordo, die mit der Promulgation des Römischen Messbuchs unter Pius V. im Jahr 1570 ihren Abschluss findet. Ziel dieser bereinigten Fassung ist es, die "altehrwürdigen Norm der Väter" wiederherzustellen. Aufgrund fehlender Kenntnis der Quellen und der liturgiegeschichtlichen Entwicklungen greifen die mit dieser Aufgabe betrauten Gelehrten jener Zeit dabei allerdings auf das an der Römischen Kurie gebräuchliche Missale von 1474 (Missale secundum consuetudinem Romane Curie) und den 1495 durch den päpstlicher Zeremonienmeister Johannes Burckard von Straßburg herausgegebenen Ordo Servandus per Sacerdotem in celebratione Missae zurück. Damit wird die stille Priestermesse mit diversen zeremoniellen Ergänzungsmöglichkeiten für feierliche Anlässe zur gesamtkirchlichen Norm des lateinischen Ritus.Während sich das Missale von 1570 etwa in Österreich, Ungarn und Polen rasch verbreitet, hält man z.B. in Mailand oder Lyon mit Genehmigung an der bisherigen liturgischen Praxis fest: Eigentraditionen, die bereits länger als 200 Jahre in Gebrauch sind, dürfen auch künftig fortbestehen. In weiten Gebieten Italiens etwa bleibt der Ambrosianische Ritus bestimmend. In den deutschen Diözesen Mainz, Worms, Speyer, Köln und Trier sowie in Konstanz bleibt es zunächst bei einzelnen Korrekturen an den bisherigen Messbüchern. Auch zahlreiche Orden, darunter Dominikaner, Prämonstratenser und Kartäuser, halten an ihrer eigenen Messliturgie fest. In Frankreich treten nach anfänglicher Rezeption des Römischen Messbuchs ab Mitte des 17. Jhd. im Kontext von Jansenismus, Aufklärung und Gallikanismus in den meisten Diözesen für etwa zwei Jahrhunderte wieder verstärkt Eigenliturgien in den Vordergrund, teilweise im Rückgriff auf alte lokale Traditionen. Insgesamt aber setzt sich das Römische Messbuch zunehmend durch, verdrängt die Eigentraditionen und setzt einen weltweit einheitlichen Standard.
Die Feier der Messliturgie wird durch das Römische Missale von 1570 homogenisiert, die zeremonielle Praxis durch Rubriken geregelt. Die Anzahl der Präfationen sinkt auf elf, aus der Fülle an Sequenzen bleiben lediglich vier bestehen. Die bisher große Anzahl an Formularen für Votivmessen wird erheblich beschnitten: Für jeden Wochentag wird je ein Votivmessformular vorgesehen, darüber hinaus zehn Votivmessen in besonderen Anliegen. Lokale Festkalender gehen im Römischen Kalendarium auf, und die Anzahl der Feste wird erheblich reduziert.
Die Vorstellung von der Kirche als gegliederter Gesellschaft wird im Kirchenbau versichtbart: Der Hochaltar mit Tabernakel bildet fortan das alleinige Zentrum des liturgischen Geschehens. Hier liest der Priester seine Messe. Dabei werden im Amt des Priesters alle liturgischen Funktionen zusammengefasst. Dieser wird bei der Messfeier durch Altardiener, welche gleichsam vom Priestertum her und auf dieses hin klerikal gedeutet werden (vgl. ital. chierico, chierichetto), zeremoniell unterstützt. Das Volk - sofern überhaupt zugegen - wohnt der Priestermesse vom Kirchenschiff aus bei, ist in die liturgische Feier selbst aber nicht aktiv involviert. Anstelle des Volkes geben Altardiener dem zelebrierenden Priester in den Dialogpartien die vorgesehenen Antworten. Das Volk bekommt von dem als übernatürlich verstandenen Geschehen praktisch nichts mit. Stattdessen verrichten die anwesenden Gläubigen seit dem 17./18. Jhd. parallel zur Messe darauf abgestimmte "private" (d.h. nicht-liturgische) Andachtsübungen wie z.B. Rosenkranz, Messandachten oder Volksgesang. Die Form der Betsingmesse, die sich im deutschen Sprachraum seit Ende des 18. Jhd. verbreitet, ist die Konsequenz aus dem sich verstärkenden Wunsch, die Gläubigen in ihrer Muttersprache einzubeziehen, wenn schon nicht in die eigentliche liturgische Feier selbst, so doch wenigstens damit synchronisiert. Auch die sakramentale Kommunion der Gläubigen erscheint nicht mehr als Bestandteil der eigentlichen Messfeier, in der Opfergeschehen und Gotteskult im Zentrum stehen, und die als in sich geschlossen betrachtet wird. Der Aspekt der Realpräsenz hingegen kommt im eucharistischen Kult in erweiterter Form zur Ausprägung, der Aspekt des gnadenvermittelnden Sakraments in der gesonderten Sakramentenspendung durch den Priester, welche mitunter bis hin zu eigenständigen Kommunionandachten zu besonderen Terminen reicht. Die Frömmigkeit forciert stattdessen die geistige Kommunion.
Reformen am Römischen Messbuch
Bei der Einführung des Missale von 1570 geht Pius V. in der Apostolischen Konstitution Quo Primum von der grundsätzlichen Unveränderlichkeit des nun vorgelegten Ordo Missae aus. Gleichwohl kommt es bereits 1604 unter Clemens VIII. sowie unter Urban VIII. 1634 zu einer Neuausgabe des Römischen Messbuchs, allerdings mit nur kleineren Änderungen an den Rubriken und einzelnen Texten. Derartige Änderungen an Rubriken, Formularen und dem Kalendarium sind auch während der folgenden Jahrhunderte immer wieder zu registrieren. Dies trifft insbesondere auf die Zeit der Pontifikate Pius IX. (1846-1978) und Leo XIII. (1878-1903) zu. Unter Pius X. (1903-1914) wird schließlich eine weiterreichende Neuausgabe des Römischen Messbuchs vorbereitet, welche allerdings erst nach dem 1. Weltkrieg unter Benedikt XV. (1914-1920) erscheint.Seit Mitte des 19. Jhd. führt die Erschließung der Quellen zur Geschichte der Kirche auch zu einer vertieften Beschäftigung mit den liturgiegeschichtlichen Entwicklungen. Eines der ersten Zentren liturgiegeschichtlichen Interesses ist die 1837 von Guéranger gegründete Benediktinerabtei Solesmes, die für eine (restaurative) Erneuerung der Liturgie aus ihren Quellen eintritt. Von Solesmes aus gründen Maurus und Placidus Wolter die Abtei Beuron. Von dort aus findet die Übersetzung des Römischen Messbuchs durch Anselm Schott OSB rege Verbreitung. Diese wie auch zahlreiche weitere landessprachliche Übersetzungen tragen zu einer verbesserten Möglichkeit der Gläubigen zur Mitfeier der Messe bei. Leo XIII. hebt 1897 die seit dem 17. Jhd. wiederholt erlassenen Verbote volkssprachlicher Übersetzungen auf und macht den Weg für die Verbreitung der Volksmessbücher frei.
In der Kirchenmusik trägt der Cäcilianismus zu einer Erneuerung und zu einer verstärkten aktiven Beteiligung der Gläubigen bei. In seiner kirchenmusikalisch ausgerichteten Instruktion Tra le sollicitudini von 1903 bringt Pius X. (1903-1914) die Forderung nach einer aktiven Teilnahme der Gläubigen an den Mysterien und dem öffentlichen und feierlichen Gebet der Kirche zum Ausdruck. Spätestens mit der Rede von Lambert Beauduin OSB auf dem Katholikentag in Mecheln 1909 erhält das Anliegen der Liturgischen Bewegung ein konkretes Profil und entfaltet in Mitteleuropa zunehmend Breitenwirkung. Die liturgischen Ansätze in der Folgezeit sind vielgestaltig und umfassen die Theologie der Liturgie (z.B. Herwegen, Casel aus Maria Laach), die Geschichte der Liturgie (z.B. Jungmann) ebenso wie die liturgische Bildungsarbeit (z.B. Pius Parsch aus Klosterneuburg). Die Liturgische Bewegung gewinnt eine breite Basis in den Pfarreien (z.B. Deutsches Hochamt), insbesondere unter den Jugendlichen (z.B. Bund Quickborn, Ludwig Wolker, Romano Guardinis Schrift "Vom Geist der Liturgie" 1918, Einführung des Christkönigsfestes 1925). Zusammen mit einem sich neu akzentuierenden Kirchenbild sowie den Arbeiten zur Pneumatologie verstärken sich die Forderungen nach einer Reform der Liturgie.
Nach dem 2. Weltkrieg macht sich Pius XII. mit der Enzyklika Mediator Dei von 1947 das Anliegen der Liturgischen Bewegung zueigen und setzt eine Kommission für die Erneuerung der Liturgie ein. 1951-55 folgt eine Reform der Liturgie der Osternacht und der Heiligen Woche, 1953 die Einführung der grundsätzlichen Möglichkeit der Abendmesse, 1957 eine damit zusammenhängende Abmilderung der Vorschriften zur eucharistischen Nüchternheit. Auch durch die Arbeit der neu errichteten liturgischen Institute (1943 Paris, 1947 Trier) und durch internationale Studientagungen (1956 Assisi, 1959 Nimwegen) werden Reformbedarfe und -ansätze artikuliert.
Nach der Ankündigung des II. Vatikanischen Konzils durch Johannes XXIII. 1959 kommt es parallel zu den Konzilsvorbereitungen 1960 zur Einführung des bereits unter Pius XII. vorbereiteten Codex Rubricarum, der Korrekturen an den bisher geltenden Rubriken und Veränderungen am Festkalender vorsieht, sowie zur Neuauflage des Römischen Messbuchs 1962. Ein Viertel aller Eingaben zur Vorbereitung des Konzils betreffen Fragen der Liturgie.
Auf dem Konzil selbst (1962-65) ist die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium das erste Schema, das beschlossen wird (1963). Kapitel 2 dieser Konstitution (Art. 47-58) behandelt explizit das Geheimnis der Eucharistie und bringt das Anliegen zum Ausdruck, dass die Gläubigen der Eucharistiefeier nicht mehr wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen, sondern dass sie bewusst, fromm und tätig teilnehmen sollen (Art. 48). Das Konzil erteilt den Auftrag, den Ordo Missae dementsprechend zu überarbeiten (Art. 50) und beschließt hierzu einige Leitlinien: Der Sinn der einzelnen Teile und ihr Zusammenhang sollen deutlicher hervortreten, die Riten sollen einfacher und entsprechend alten Traditionen wieder ursprünglicher werden. Die Liturgie des Wortes soll wieder ein größeres Gewicht erhalten (Art. 51, 56), dabei sollen Homilie (Art. 52) und Allgemeines Gebet (Art. 53) die ihnen gebührende Bedeutung wieder erhalten. Schließlich stärkt das Konzil auch den Gebrauch der Muttersprachen innerhalb der Eucharistiefeier (Art. 54) und eröffnet die Möglichkeit der Konzelebration (Art. 57, 58).
Liturgiereform nach dem II. Vatikanischen Konzil
Die Überarbeitung des Ordo Missae gemäß den Konzilsvorgaben erfolgt ab 1964 durch den Rat zur Durchführung der Liturgiekonstitution (Liturgierat) , der nach Abschluss der Arbeiten 1969 zusammen mit der Ritenkongregation in der neu eingerichteten Kongregation für den Gottesdienst organisatorisch aufgeht.In einem ersten Schritt wird bereits am 27. Januar 1965 eine noch provisorische Fassung der überarbeiteten Messordnung offiziell eingeführt. Dabei werden z.B. Eröffnungsriten und Liturgie des Wortes nicht mehr vom Altar aus gefeiert, außerhalb des Hochgebets kann die Volkssprache Verwendung finden, und den Priestern wird freigestellt, dem Volk zugewandt (versus populum) zu zelebrieren. Die weitere Überarbeitung des Ordo Missae nimmt noch einige Jahre in Anspruch. Paul VI. nimmt mehrfach persönlich Einfluss auf den Fortgang der Arbeiten: So wird auf seinen Wunsch u.a. am Kreuzzeichen zu Beginn der Eucharistiefeier und am bisherigen Kanon, wenn auch in leicht überarbeiteter Form, festgehalten. Statt einer tiefgreifenden Überarbeitung des Kanon werden diesem drei alternative Hochgebetstexte zur Seite gestellt.
Durch die Apostolische Konstitution "Missale Romanum" vom 3. April 1969 führt Paul VI. den neugestalteten Ordo Missae sowie den neuen Festkalender offiziell ein. Das neue Messbuch wird 1970 herausgegeben. Die deutsche Ausgabe wird nach Übersetzung, Approbation und päpstlicher Bestätigung zum ersten Fastensonntag 1976 eingeführt. Nach einer 2. verbesserten Ausgabe des lateinischen Messbuchs 1975 wurde 2002 unter Johannes Paul II. eine 3. authentische Ausgabe aufgelegt, die einzelne zwischenzeitliche Änderungen, so etwa die Hinzufügung von sechs weiteren eucharistischen Hochgebeten, Orationes super populum, weitere Messformulare sowie Änderungen im Kirchenrecht (CIC/1983) und in der Institutio Generalis z.B. hinsichtlich Anpassungsmöglichkeiten durch die Bischofskonferenzen berücksichtigt.
Aufgrund der ihr innewohnenden Geschichtlichkeit ist zu erwarten, dass die Feier der Eucharistie auch künftig weiteren Entwicklungen innerhalb der dynamischen Kontinuität der Tradition unterliegen wird.
frühchristliche Herrenmahlpraxis
Entwicklungen im Kontext der Römischen Reichskirche
fränkisch-germanische Einflüsse
Akzentuierungen im Mittelalter
antireformatorische Akzentuierung
← zurück zur Übersicht über das Angebot von eucharistie-online